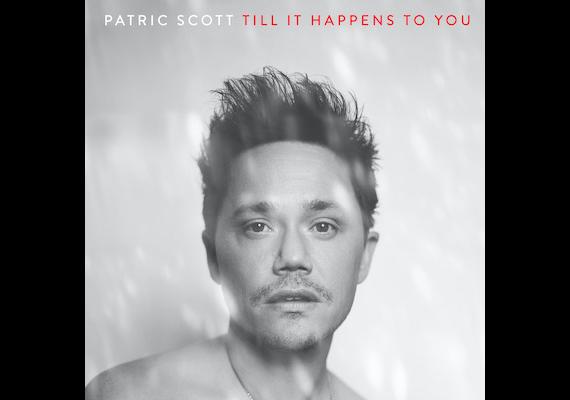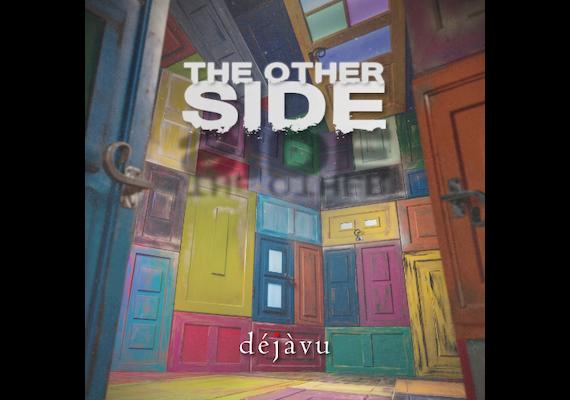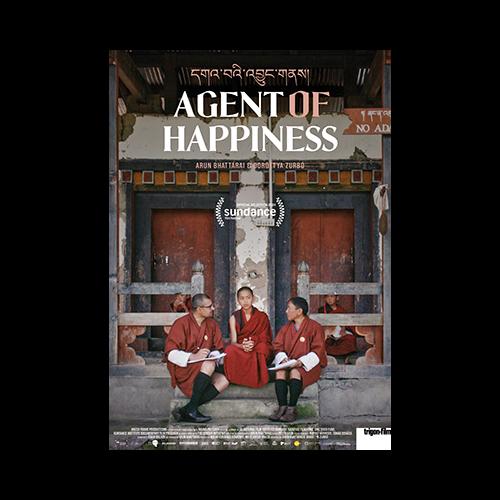Venusfalle im Rückwärtsgang
Im Jahr der Herren 2013 erfährt die verschworene Herde der schwarzen Schafe einmal mehr der Götter geweihte Gnade. Das Triumvirat des Technopop treibt sich selbst die Teufel aus und streichelt das Kätzchen gegen den Strich, bis es bellt …
«Ja! Natürlich!» antwortet Fletch, als ihn ein Reporter an der Pariser Pressekonferenz fragt, ob Depeche Mode im Angesicht von soviel Synthie-Nachwuchs noch immer die Meister der Tasteninstrumente seien. Es ist Ende Oktober Nullzwölf und die Band beantwortet höflich, aber mässig interessiert Fanfragen der nebensächlichen Sorte. Eigentlich will sie vor Millionen YouTube-Zuschauern lieber Werbung für ihre nächste Welttournee machen. Und das obwohl deren dazugehöriges Album noch gar keinen Titel trägt. Tatsächlich wurde der Longplayer erst am Vorabend fertiggestellt und soll die nächsten fünf Monate unter Verschluss bleiben. Nicht einmal eine Vorabsingle können sie vorweisen. Nur eine schwarzweisse Videocollage von den Studioaufnahmen, unterlegt mit einem herausfordernden, namenlosen Song, der so klingt als hätte man «I feel you» und «A Pain that I’m used to» in ein Einmachglas gepresst, Valium durch den Korken gespritzt und die rostige Suppe unter Strom gesetzt. Auf die Marschrichtung der Platte angesprochen, redet Songwriter Martin Lee Gore dann vage von musikalischen Parallelen zu den legendär erfolgreichen Alben «Violator» und «Songs of Faith and Devotion» (SOFAD) …

Depche Mode in kühlen Blau. Passend zur Stimmung von «Delta Machine»? (Pressebild Sony / © Anton Corbijn)
Nun also liegt es vor. Das dreizehnte reguläre Werk, auf «Delta Machine» getauft, vereint in der Tat die besten Elemente eben benannter Platten, und jene von «Exciter» obendrein. Die nasskalt triefende Verzweiflung von «Ultra», man sucht sie genauso vergeblich wie die süffigen, weil weitgehend unreflektierten, Wutbürger-Hymnen von «Playing the Angel». Selbst die gefällige Unart der 2009er Platte «Sounds of the Universe», Songs nur bis zum Ende des ersten Refrains auszureifen und den Rest von Copy/Paste erledigen zu lassen, ist manch unorthodoxem Aufbau gewichen. Dies erstaunt umso mehr, da die Band bereits ihren dritten Anlauf mit dem in Fankreisen munter debattierten Produzenten Ben Hilier nimmt. Gewiss, im direkten Vergleich zu den beiden Vorgängern haben sie zwar keinen Lichtsprung hingelegt, aber die Aussicht, Sänger Dave Gahan nach einer Blasenkrebs-Diagnose 2009 zu verlieren, muss das gesamte Team dazu gebracht haben, einen neuen Zugang zueinander zu finden. Das liest sich in den Texten und das hört man deutlich an den Stellen, wo David Gahan und Gitarrist Martin Gore gemeinsam singen. Doch nicht nur am Mikrophon ist die Harmonie frisch. Wieder einmal hat Dave – unterstützt von einem gewissen Kurt Uenala - drei Songs beigesteuert, die sich perfekt neben jene von Gore betten. Zwei davon tragen unverkennbar seine Handschrift. Zum dritten kommen wir später. Einen grossen Beitrag dürfte auch der von Hilier vorgeschlagene Audioingenieur Mark «Flood» Ellis geleistet haben, der den Endmix anfertigte. Flood hatte zwar einst einen heiligen Eid geleistet, sich nach den äusserst traumatischen Aufnahmen zu «SOFAD» nie wieder mit der Gruppe in ein Studio zu begeben, doch die Zeit, sie lindert den Schmerz und nährt die Erinnerung.
«Elend ist mir fremd»
Und dass in der Tat ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde, macht das knorrige «Welcome to my World» gleich zu Beginn klar. Die kraftvoll dahinpluckernde, wenngleich etwas unbewohnte Nummer preist unverhohlen Hoffnung und Aufbruch. «Angel», der phasenverschobene Song von der Pressekonferenz, lässt darauf die Kopfhöher anschwellen und teilt seine sakral-klaustrophobische Stimmung mit jener der ersten Single «Heaven» - einer mit Goldpatina verzierten Hochlangsamkeits-Ballade. Das nächste grosse Gebaren «Secret to the End» huldigt feisten Analogsounds und bewegt sich stilsicher irgendwo zwischen Alan Parsons’ «Lucifer» und dem «Tripods»-Soundtrack. Nach so viel Achtzigern geht es neuzeitlich-minimalistisch weiter. Der Hörer trägt liebevolle Kratzspuren vom kaktusähnlichen «My little Universe» davon, die sogleich von der lustgetränkten Bettlaken-Hymne «Slow» einbalsamiert werden. Das Stück war bereits in den frühen Neunzigern geschrieben worden und wirkt darum wie ein seliges Echo von «SOFAD».
Genau in der Mitte ihrer Betriebszeit erleidet die Dreiecksmaschine einen Schluckauf. «Broken» wirkt wie der demente Cousin von «In Sympathy» und vergibt viel Wohlwollen mit seiner wenig zauberhaften Akkordfolge im Refrain. Schlecht ist der Song nicht. Ungelogen herzig, aber irgendwie auch belanglos. Gleiches gilt für «Soft Touch / Raw Nerve» – ein geloopter Auftakt, ein hyperaktiver, endloser Countdown, der doch nie zur Zündung kommt. Dazwischen ergibt sich das Vergnügen des einzigen von Martin gesungenen Songs. «Child inside» ist ein kleines Juwel für den eingefleischten Fan, doch dem gewöhnlichen Konsumenten bestimmt zu brav. Nun der Knüller. Das erstmals in der Letterman-Show präsentierte «Should be higher» - in den Foren bereits frenetisch gefeiert - stammt ebenfalls aus Gahans Feder. Kommt es zu Beginn noch als DUR-Version von «Corrupt» daher, schwingt es sich im Refrain von umgerechnet einer Billiarde Hall verstärkt in ätherische Sphären auf.

Die Band in der Natur und mit sich selbst vereint. (Pressebild Sony)
Dann, überraschend spät, wird schliesslich der DM-Königsdisziplin gefrönt; dem Klagelied. In «Alone», einem ergreifenden Stück über eine endgültig verpasste Aussprache, demonstrieren die Engländer artistisch, wie man unterschiedlichste Elektroniksounds zu einem organischen, atmenden Ganzen verwebt. Es sind Lieder wie dieses, die Vergleiche zu «Violator» heraufbeschwören und rechtfertigen. Und kurz vor Schluss wird’s nochmal lüpfig-hüpfig. Die zweite Single «Sooth my Soul» tanzt mit den Stiefeln von «Personal Jesus», doch kaum wähnt man den Song durchschaut, hat er seine Suchtwirkung schon vollends entfaltet. Zum Abschied heisst es dann «Goodbye». Depeche Mode jagen ihre Dämonen mit Ohrfeigen zum Teufel. «Es ist unbestreitbar, wie sehr ich mich verändert habe. Du wirst mich nicht weinen hören, nun ist mir Elend fremd.» Das klingt geläutert. Das klingt glaubwürdig. Und das haben sie uns alles schon 1990 im Song «Clean» erzählt. Doch es drohen wohl weder ein Rückfall noch die ausgehöhlte Langweile von Altersweisheit. «Deine Lügen sind viel reizvoller als die Wahrheit», singt Dave in «Should be higher». Zu Heiligen werden sie zwischenzeitlich kaum geworden sein, aber nachweislich ein bisschen weniger sündig …
Im Geiste vertreten
Wenn Platten von Depeche Mode eines gemeinsam haben, dann dass sie beim ersten Durchhören schillernde Plantagen voll bizarrer Pflanzen von einem anderen Stern entstehen lassen. Stacheligen, auf Anhieb abweisenden Gewächsen, die ihre exotischen Reize erst nach mehrmaliger Hingabe entfalten. Der Hörer wird zur Beute gemacht und so lange gebannt, bis sich die Blüten vollständig geöffnet haben. Wie Venusfallen eben. Einfach rückwärts. Und so bei Sinnen wie auf «Delta Machine» haben wir die Engländer schon lange nicht mehr erlebt. Die inbrünstigen Gesänge. Die flatuleszierenden Peitschenbässe. Das Frickeln, Brutzeln, Knistern, Knuspern und Glitzern. Die schrullige, überraschend selten vertretene Bluesgitarre. Die Kodamas und Wesenheiten, die seit jeher die Songs bewohnen (etwa am Ende von «Should be higher»). Jeder Ton ist millimetergenau platziert und keiner ist zu viel. Diese virtuose Detailverliebtheit legt ein Trostpflaster auf die nie heilen wollende Wunde über den Weggang von Arrangier-Genie Alan Wilder. Und Fans der ersten Stunde werden sich über eine Begegnung mit der Präsenz von Vince Clark freuen – dem Mann, der fast alle Songs auf dem ersten Album «Speak and Spell» schrieb und später mit Erasure unzählige Welterfolge feierte. Beide unvergessen und im Geiste vertreten.
Relevanz vor Innovation
Natürlich wurde «Violator» nicht erreicht. Jener Quantensprung war schliesslich nur möglich, weil Produzent Flood die Band trickreich aus ihrer Komfortzone zu locken vermocht hatte. Heute, längst auf dem Thron ihres quasi selbstgeschaffenen Genres angekommen, betont Martin Gore zwar, dass Best-Of-Tourneen und bare Selbstverwaltung bestimmt nie zum Thema würden, doch warum sollte die Band das Dreirad neu erfinden, wenn sie einen derart über die Jahre gereiften Sound präsentieren kann? Babylonier lassen sich ohnehin nicht bekehren und heftige Diskurse unter den Fans sind Teil der Tradition. So ziehen Depeche Mode die Relevanz der Innovation vor und demonstrieren wieder einmal souverän, dass man auch innerhalb des Kosmos der sich rasch morphenden Elektronik zeitlose Musik schaffen kann. Mögen sie für ihre eigenen Kinder peinlich uncool sein, für eine schwindende Anzahl Radiohörer alte Säcke; Wenn die drei zusammenfinden, dann entsteht noch immer Religion. Habemus De Em.
Wir verlosen in Zusammenarbeit mit Sonymusic 3 Exemplare von «Delta Machine».
Wettbewerbsfrage: Woher stammt der Name Depeche Mode?
Schreibe eine Mail mit deiner Antwort, Adresse und dem Stichwort «Mode» an patrick.holenstein@baeckstage.ch. Einsendeschluss ist der 6. April.
- Künstler: Depeche Mode
- Album: Delta Machine
- Verkaufsstart: 22. März 2013
- Depeche Mode Live: 7. Juni Bern und 9. Juli Locarno