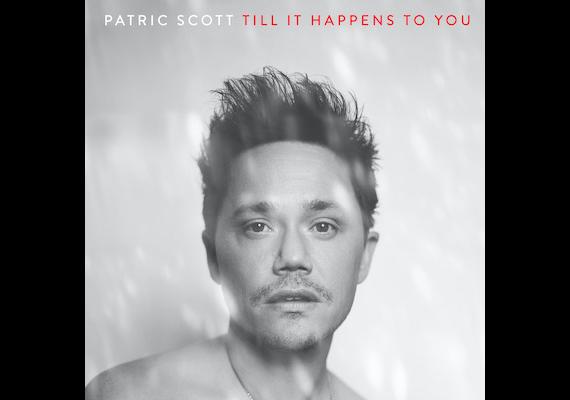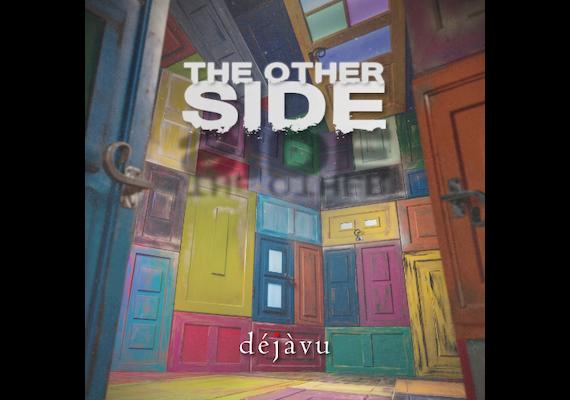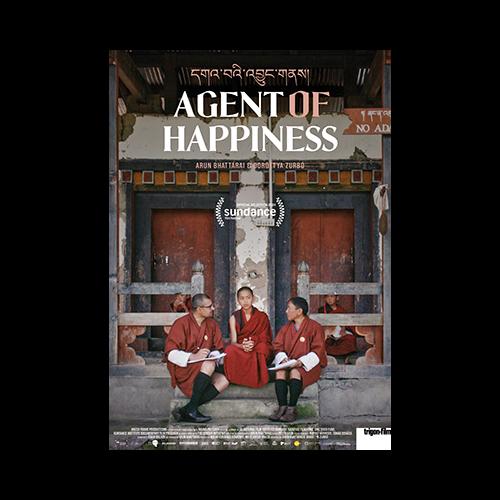Ewan McGregor: «Ich wollte keinen Schwarz-Weiss-Film machen»

Mit «American Pastoral» liefert Ewan McGregor mit 45 Jahren sein Regiedebüt ab. Bäckstage hat den Filmemacher anlässlich der Premiere am Zurich Film Festival zum Interview getroffen. Der charismatische Schotte erzählte dabei von verpassten Regiechancen, seinen Lieblingsmusikstücken aus den 60er-Jahren und worauf er bei Jane-Austen-Adaptionen achten muss. Zugleich gewährte er einen ersten Einblick in die «T2:Trainspotting»-Dreharbeiten und stellte sich der Frage, ob ihn ihm ein Jedi-Ritter schlummert oder nicht.
Unsere Filmkritik gibt es hier: «American Pastoral»
Herzliche Gratulation zum Film. Wunderschön inszeniert. Warum hast du eigentlich nicht früher angefangen Filme zu drehen?
(Lacht). Herzlichen Dank, das freut mich zu hören. Und ja, was für eine Zeitverschwendung! Ich hätte vielleicht früher anfangen sollen, aber ich habe einfach nie die richtige Geschichte gefunden. Zum ersten Mal Regie führen wollte ich, nachdem ich «Silk» von Alessandro Baricco gelesen hatte. Es reizte mich halt schon immer, über den ganzen Filmprozess hinweg involviert zu sein und zusammen mit Kostümbildnern und Kameraleuten die Geschichte zum Leben zu bringen. Aber ich wollte es nicht nur der Erfahrung wegen, um später gross anzugeben, sondern mich einbringen, wenn eine Geschichte daherkommt, die ich wirklich erzählen möchte. Ich dachte «Silk» wäre diese Geschichte, doch ich war zu ängstlich, um mir die Filmrechte zu sichern und so nahm sie ein anderer und drehte den Film.
Und wie war das nun bei «American Pastoral»?
Ich war dem Drehbuch zugetan. Und das während Jahren. Auch Jennifer Connolly und Dakota Fanning haben sich dem Projekt angeschlossen, aber mit dem Regisseur wollte es nicht klappen. Kurz vor Drehdrehbeginn sprang der Regisseur (Phillip Noyce, Anmerkung der Redaktion) ab. Ich dachte, dass wäre es nun mit dem Film. Meine Frau Eve ermutigte mich jedoch darin, selbst Hand anzulegen und auch die Regie zu übernehmen. Mein Agent war der gleichen Meinung und die Produzenten zum Glück auch. (lacht) Aber es ist schon so, dass Filmemacher, Geschichten wie «American Pastoral» für ihr zweites Werk wählen, nicht für das Debüt. Darum stelle ich mir auch vor, dass ich als nächstes Regiewerk etwas völlig gegensätzliches zu «American Pastoral» wählen könnte. Damit ich eben auch ein kleines, verrücktes, unkonventionelles Debüt abliefere (lacht).
Was war deine grösste Herausforderung bei der Regiearbeit?
Zu wissen, was ich genau machen will. (lacht) Und was ich genau erzählen möchte. Roth scheibt seine Bücher immer sehr ausgeglichen, jedes Argument wird abgewogen, jede Sicht kommt zur Geltung. Da noch zu wissen, was der Autor eigentlich aussagen wollte oder was ich als Filmemacher mit dem Film erzählen möchte, ohne etwas Eigenes daraus zu machen, ist herausfordernd. Und ich wollte keinen Schwarz-Weiss-Film machen und die Charaktere nicht einer einfachen Interpretation des Publikums überlassen, sondern sie so menschlich wie möglich zeigen. Ich möchte beim Publikum Verständnis für ihre Taten auslösen.
Ich wollte «Voodoo Child» von Jimi Hendrix im Film spielen hören, doch der Song war schlicht zu teuer.
Der Film spielt in den 60er-Jahren, in denen Musik auch Form von Protest war. Wie wichtig waren dir die Songs, die im Film zu hören sind?
Sie war sehr wichtig. Als ich eines Morgens in Pittsburgh, wo wir drehten, duschte, kam «Heaven on Earth» von den Platters im Radio. Und ich wusste sofort, dass wir den Song integrieren müssen. Wir haben generell nie mit Musik gedreht, weil die Musik die Atmosphäre sehr beeinflussen kann und später beim Schnitt wollte ich mehr Freiheiten haben. Aber ja, wir haben «Heaven on Earth» ausprobiert und der Song passte. Gleiches passierte später in der Bahnhofsszene mit Clearwater. Aber ich konnte nicht alles haben, was ich wollte. In einer Szene mit Dakota Fanning, hätte ich mir gewünscht, dass sie «Voodoo Child» von Jimi Hendrix hört, aber der Song war schlicht zu teuer. Gleiches gilt für «Take Five» von Dave Brubeck. Mit Alexandre Desplat konnte ich aber einen fantastischen Komponisten für den Film gewinnen. Und so ist nun eine wunderbare Kopie von «Take Five» im Film zu hören. (lacht)
Wie es der Name schon sagt, ist «American Pastoral» eine zutiefst amerikanische Geschichte. Du kommst ursprünglich aus Schottland. Hat das je eine Rolle gespielt?
Prinzipiell muss ich meinen Figuren als Person nicht ähneln, schliesslich spiele ich sie ja nur. Und schlussendlich geht es darum eine Persönlichkeit darzustellen, ganze gleich welcher Religion, Heimat oder Zeit die Figur angehört. Wobei es natürlich schon einen Unterschied macht, wenn ich einen Gentleman in einer Jane-Austen-Adaption spiele, da die Sitten und Gebräuche anders waren als heutzutage. (lacht) Bei «American Pastoral» steht die Kollision zweier Generationen – der Nachkriegsgeneration und der Generation der 68er-Bewegung - im Mittelpunkt. Also musste ich mich stark einlesen und viel dazulernen über diese Zeit. Es ist eine Hürde, aber keine unüberwindbare, man muss daran arbeiten. Danny Boyle ist beispielsweise ja auch kein Schotte und hat mit «Trainspotting» den wohl schottischsten Film der Geschichte gedreht.
Das heisst aber auch, dass du kein Jedi-Ritter bist, sondern nur einen gespielt hast?
(Lacht) Nein, ich bin kein Jedi, definitiv nicht.
Und du hast es vorhin erwähnt: «T2» (Ewan hebt Augenbraue). Erzähl mir bitte etwas darüber.
Der Film ist fertiggedreht, dass darf ich dir verraten. (lacht) Wir haben diesem Sommer in Edinburgh gedreht. Alle sind wieder zurück und mit von der Partie, Danny als Regisseur und wir vier Jungs, Robert Carlyle als Begbie, Ewan Bremer als Spud, Johnny Lee Miller als Sick Boy und ich als Renton. Und vielleicht noch ein paar weitere Personen. (grinst schelmisch) Es war eine grossartige Erfahrung. Aber es war ziemlich nervenaufreibend. Für uns alle. Nach 20 Jahren waren wir nicht sicher, ob wir diese Figuren wieder zum Leben aufwecken konnten, ob wir sie wieder in uns finden können. Aber es dann doch geklappt. (lacht)