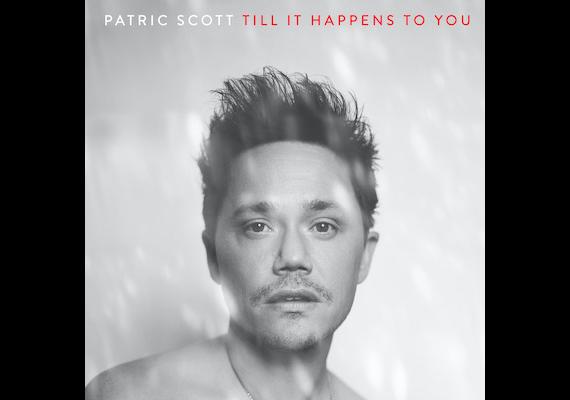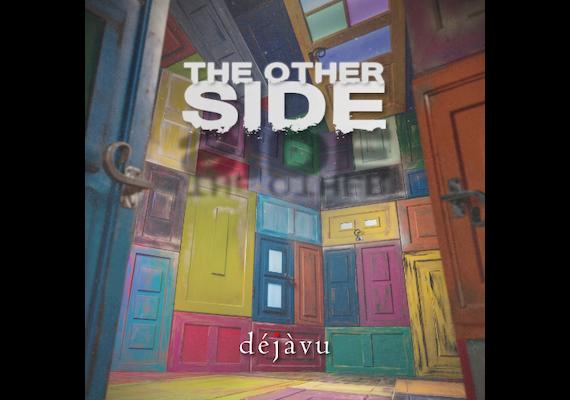Viggo Mortensen: «Ich bin froh, dass ich die Rolle annahm»

Mit «Green Book» läuft aktuell ein Drama in den Kinos, das auf einer wahren Begebenheit beruht und als Oscar-Favorit (5 Nominierungen, darunter «Bester Film» und «Bester Hauptdarsteller» für Viggo Mortensen) gehandelt wird. Es erzählt von einem Reiseführer, der Afro-Amerikaner sicheres Reisen in den US-Südstaaten ermöglichte. Wir haben Hauptdarsteller Viggo Mortensen und Regisseur Peter Farrelly zum Gespräch im Baur au Lac getroffen.
Hatten Sie vor Drehbeginn jemals von Tony Lips und Dons Shirleys Geschichte gehört?
Viggo Mortensen: Nein, ich habe das Drehbuch gelesen und mich darauf mit Nick Vallelonga getroffen, der es mitverfasst hatte und Tonys Sohn ist. Später lernte ich auch seine Familie im italienischen Restaurant «Tony Lip» in New Jersey kennen, das Nicks Bruder gehört. Ich tauchte in ihre Welt ein und lernte eine Menge. Sie zeigten mir Bilder und Videos, in denen Tony über seine Rundreise mit Don sprach und besuchte die Orte in der Bronx, wo er gelebt hatte.
Diesbezüglich: Sie stammen selbst aus New York und sind daher bestimmt mit der City vertraut. Wie gut kannten Sie die Welt der New York-Italiener in den Sechzigern?
Wie die meisten Leute wusste ich eine Menge aus Filmen, Dokumentationen und Fernsehserien. Ich wurde in Manhattan geboren, zog aber weg, als ich sehr jung war. Mein Vater fand Arbeit in Südamerika, und so verbrachte ich das erste Jahrzehnt meines Lebens in Argentinien. Ich kam mit der italienischen Sprache und Kultur in Kontakt, denn es gibt eine Menge italienische Einwanderer in Argentinien. Die Hälfte der argentinischen Fussballnationalmannschaft hat italienische Namen. Nachdem Green Book abgedreht war, wurde mir klar, dass ich zuvor noch nie einen New Yorker gespielt hatte, obwohl ich selber aus der Stadt stamme. Ich machte mir viele Gedanken, denn ich wollte Tony weder oberflächlich, noch als Karikatur darstellen. Er sollte wie ein echter Mensch rüberkommen. Aber die Zeit, die ich mit Tonys Familie verbrachte, half mir sehr. Nick war jeden Tag am Set und achtete darauf, wie ich ass, rauchte und sprach. Oft sagte er: «Ja, das klingt wie mein Vater!» Alles sollte sich authentisch anfühlen, egal, ob es sich um eine lustige oder ernste Szene handelte.
Wieso haben Sie sich für diese Rolle entschieden?
Weil mich Pete Farrelly, der Regisseur, dazu überredete (lacht). Er kann sehr überzeugend sein. Nein, es war eins der besten Drehbücher, das ich je gelesen hatte, aber aus den eben genannten Gründen war ich nervös. Ich bin kein Italo-Amerikaner, und von denen gibt es eine Menge toller Schauspieler, auf deren Konto einige der besten Momente der US-Filmgeschichte gehen. Ich sagte zu Pete: «Das ist ein tolles Script und eine wunderbare Person. Es ist mitreissend, lustig und regt zum Nachdenken an. Aber ich weiss nicht, ob ich der ideale Schauspieler dafür bin. Könntest du nicht jemanden finden, der dafür geeigneter ist?» Doch er wollte nicht einen der üblichen Verdächtigen engagieren, weil er den Fokus auf die Geschichte lenken wollte. Die Leute sollten nicht automatisch an Italiener in anderen Filmen denken. Das erwies sich als geschickt, wenngleich es auch eine grössere Herausforderung für den Regisseur darstellte. Denn im Fall von mehreren Figuren wurden Laiendarsteller gecastet. Tony Lips Vater wird von Tonys eigenem Bruder gespielt, und Tonys Sohn spielt Tonys Bruder. Alles Leute, die noch nie vor der Kamera gestanden hatten. Aber es wirkte alles echt.
Sie sind als Schauspieler sehr facettenreich. Und Tony ist eine ziemliche Erscheinung. So jemanden nennen wir in der Schweiz einen Kasten. Wie haben Sie sich physisch auf die Rolle vorbereitet?
Es ging ja nicht nur darum, wie ich aussehe. Viele Szenen drehen sich ums Essen, und die wurden aus allen möglichen Blickwinkeln aufgenommen. Daher dachte ich mir, wenn ich Gewicht zulege, dann kann ich es genauso gut geniessen. Aber ich habe noch nie eine derartige Rolle angenommen, mit so vielen komödiantischen Aspekten. Es erinnerte mich an David Cronenbergs «Eine dunkle Begierde», in dem ich einen jungen Sigmund Freud mimte. Auch dort überzeugte mich der Regisseur davon, dass ich diese Rolle spielen könnte, obwohl sich jener Part ebenfalls abseits dessen befand, was ich zuvor gemacht hatte. Es gab viel mehr Dialoge, doch sobald ich mich darauf einliess, genoss ich die Arbeit, welche für mich eins der besten Erlebnisse meiner Karriere darstellt. Und dasselbe denke ich über Tony. Ich bin froh, dass ich die Rolle annahm. Manchmal ist es gut, sich als Schauspieler aus der eigenen Komfortzone zu bewegen. Und darum dreht sich auch die Handlung von «Green Book»: Beide Hauptfiguren müssen sich aus ihrer Komfortzone bewegen. Kulturell und sozial. Dabei entwickeln sich beide weiter und öffnen sich einander. Tony erhält von Don eine Lektion über Ethnien und Kultur, während Don von Tony lernt, wie wichtig Menschlichkeit und Familie sind. Es war für beide eine bereichernde Reise.
Hatten Sie zuvor von diesem Green Book gehört?
Nein, und ich glaube nicht mal Afro-Amerikaner wussten darum – es sei denn, sie stammen aus einer älteren Generation. Die Publikation wurde um 1965 eingestellt. Das hängt mit dem Civil Rights Act von 1964 zusammen, der kurz nach den Ereignissen in unserem Film stattfand. Aber ich habe rein zufällig mal ein Kinderbuch gelesen, «Ruth and the Green Book». Eine Geschichte aus der Perspektive eines jungen, afro-amerikanischen Mädchens, das mit seinen Eltern ihre Grossmutter in den Südstaaten besucht. Sein Vater hatte eine Art Reiseführer dabei, weil sie nur gewisse Tankstellen und Restaurants besuchen durften. Dies, um Gefahren auszuweichen und damit sich die Eltern nicht vor den Kindern blamierten, wenn sie nicht auftanken oder für Speis und Trank einkehren konnten. Und an dieses Buch erinnerte ich mich noch.
Was ist für Sie die Kernbotschaft des Films?
Dass wir Menschen nicht so unterschiedlich sind, wie wir manchmal aus Ignoranz oder der Furcht vor dem Ungewissen glauben. Oder weil unsere Politiker es uns einreden, um die daraus resultierenden, eingebildeten Differenzen auszuschlachten. Im Grunde sind wir in unserem Inneren alle gleich. Und oft bedarf es nur einer gemeinsamen Reise – ob mit dem Auto oder einem Gespräch – um festzustellen, dass das Gegenüber gar nicht so anders ist als wir selbst. Wenn der Film den Leuten dies vermitteln kann, bin ich zufrieden.
Trailer zu «Green Book»
Peter Farrelly, Ihr Film ist sehr herzerwärmend, behandelt aber ein ernstes Thema. Wie ist es Ihnen gelungen, dem Film gleichzeitig Tiefe und Leichtigkeit zu verleihen?
Peter Farrelly: Als wir das Drehbuch schrieben, fielen uns einige Lacher ein, aber ich hielt es nicht für sonderlich witzig, bis ich Viggo und Mahershala (Ali, der Don Shirley spielt. Nominiert für einen Osacr® als Bester Nebendarsteller) traf. Ich schaute ihnen hinter der Kamera zu und fand ihre Performance köstlich. Ich erzählte den Leuten zwei Jahre lang, dass ich mein erstes Drama drehe. Was ich jedoch erhielt, war eine Kombination aus grossartigen Darstellern und einer wahren Geschichte, welcher ich treu bleiben wollte. Da war nämlich stets die Versuchung, dem altbekannten Motiv des ungleichen Paares zu folgen und die Ereignisse zu überzeichnen. Doch das hätte dem Drama Abbruch getan.
Warum haben Sie sich entschieden, die Regie zu übernehmen?
Ich traf eines Tages auf Brian Currie, einen der Autoren, und er erzählte mir, er würde an einem Drehbuch arbeiten. Er sagte, es basiere auf der Lebensgeschichte vom Vater eines Freundes. Von Tony Lip, der 1962 einen schwarzen Konzertpianisten durch die Südstaaten chauffierte. Tony war eigentlich selbst ein Rassist und ging trotzdem mit Don auf Tour. Das fand ich phänomenal und fragte, ob das wirklich eine wahre Geschichte sei. Zwei Monate später rief ich ihn an und wollte wissen, wie das Script vorankomme. Und da es noch nicht fertig war, bot ich meine Hilfe an, um es gemeinsam zu vollenden. Ich hatte also Glück, denn ich hatte nicht unbedingt vorgehabt, ein Drama zu drehen. Ein weiterer Beweggrund war die Überdosis vom Sohn meines Bruders. Derzeit ein monströses Problem in den Staaten. Das war sehr dramatisch und spielte auch in die Wahl dieses Projekts.
Hat Mahershala eigentlich selbst Klavier gespielt?Er hat oft Klavier gespielt. Aber wir arbeiteten mit einem Profi. Ich suchte nach dem besten dunkelhäutigen Pianisten des Landes, und fand mit Kris Bowers einen unglaublichen Typen. Als ich ihn anrief, hatte er aufgrund seines vollen Terminkalenders Bedenken. Doch ich sagte ihm, dass er die Stücke selber komponieren könne. Da sagte er zu. Aber auch Mahershala legte sich ins Zeug. Er übte, wie man korrekt an einem Piano sitzt – was schwieriger ist, als es aussieht. Und gewisse Parts konnte er für die Nahaufnahmen sogar selbst spielen. Ausserdem ist Mahershala als Person ganz anders als Don. Die meisten Schauspieler verkörpern auf der Leinwand meist eine leicht abgeänderte Version ihrer selbst. Aber für meine beiden Hauptdarsteller galt das überhaupt nicht.
Entschieden Sie sich dazu, den Film zum jetzigen Zeitpunkt rauszubringen, weil es in den Staaten noch immer Rassenprobleme gibt?
Als ich von der Story hörte, wusste ich, dass sie echt gut in die heutige Zeit passt. Damals war mir das Green Book unbekannt, und das galt für die meisten Leute in den USA. Selbst 85% Prozent der Afro-Amerikaner wussten nichts darüber. Wir Amerikaner haben in jüngster Vergangenheit ja einige Rückschritte getätigt, sodass der Stoff auf mich zeitgemäss wirkte.
Als Sie sich in diese Zeit zurückversetzten, was ging Ihnen da durch den Kopf?
Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht war. Ich habe einige Filme in Atlanta gedreht, einer grossartigen Stadt mit viel Diversität. An der Oberfläche kommen alle prima miteinander aus, bis man um 1 Uhr morgens mit diesen weissen, gut gebildeten Jungs abhängt, die ein Glas Scotch zuviel getrunken haben. Dann fällt schon mal die N-Bombe, und man denkt: «Wie bitte?!?» Darauf angesprochen, versucht man sich natürlich herauszureden und begreift nicht, wie dringend nötig ein Wandel ist. Ich wuchs im Norden von Rhode Island auf und hatte dort diesen Begriff noch nie gehört. Ich wusste darum, aber niemand nahm das Wort in den Mund. Dabei geht es nicht nur um Weiss oder Schwarz, sondern auch um Menschen mit Einschränkungen. Wenn Sie niemanden kennen, der im Rollstuhl sitzt, wissen Sie womöglich auch nicht, wie man mit so jemandem umgeht. Gleiches mit Blinden oder Menschen mit geistigen Einschränkungen. Erst durch die Interaktion wird uns klar, dass wir am Ende alle gleich sind und uns nur die Furcht voreinander trennt. Ich wollte mit dem Film keinen Kommentar über Trump abgeben, denn egal auf welche Seite ich mich stelle; ich werde die andere Hälfte des Publikums dadurch verlieren. Dabei möchte ich, dass dieser Film von möglichst vielen Menschen gesehen wird, weil er die Leute zusammenführt. Er erinnert uns daran, dass wir manchmal bloss aufeinander zuzugehen brauchen, um die Dinge zu verbessern.
Bevorzugen Sie eher wahre Geschichten oder die Fiktion?
Gute Frage. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich bin mir nicht sicher. Green Book ist eine wunderbare Story und es ist schön, wenn man sich nichts aus den Fingern zu saugen braucht. Selbst die Szene mit Robert F. Kennedy hat sich so ereignet, auch wenn ich es zunächst nicht glaubte. Alles ist so passiert, wie wir es zeigen. Sich eine so gute Geschichte komplett auszudenken, ist wahrlich schwieriger.
Gab es Improvisationen oder folgten die Schauspieler gewissenhaft dem Drehbuch?
Wir arbeiteten hauptsächlich mit dem Drehbuch. Weicht man davon ab, kann man tolle Resultate erzielen – speziell mit Leuten wie Bill Murray. Der ignoriert seine Sätze ständig und macht dadurch alles besser. Hier hätte das weniger gut funktioniert. Es gab ein paar Anpassungen, aber grundsätzlich blieben wir dem Papier treu.
Wie finden es generell, wenn jemand vom Script abweicht – von Bill Murray mal abgesehen?
Es kann arg danebengehen. Manche haben es versucht und wirkten dabei überhaupt nicht witzig. Meist lasse ich alles wie vorgedruckt drehen und räume den Darstellern einen Freiraum an, denn jeder sollte die Gelegenheit haben, sich selbst einzubringen. Der einzige, der sonst noch die Improvisation beherrscht, wäre Jim Carrey.
Viggo und Mahershala passen sehr gut zusammen. Besonders mit Ihnen als Regisseur. Werden Sie drei bald wieder für ein Projekt zusammenkommen?
Dafür wäre ich sofort zu begeistern. Für mich sind das die derzeit besten Darsteller überhaupt. Ich konnte anfangs kaum glauben, dass ich die zwei für meinen Film gewinnen konnte. Von Viggo war ich schon lange ein grosser Fan. Und als ich ihn verpflichtete, konnte ich jeden anderen Darsteller der Welt haben und entschied mich für Mahershala, der kurz zuvor den Oscar® (für «Moonlight», Anm. d. Red.) gewonnen hatte. Die Qualität der beiden macht einen Grossteil vom Zauber des Films aus.
- «Green Book» läuft seit Donnerstag, 31. Januar 2019 in Deutschschweizer Kinos