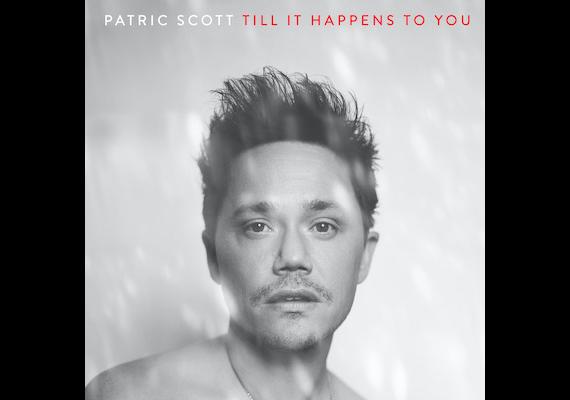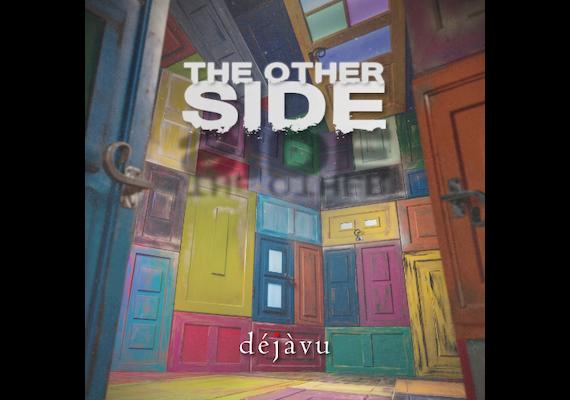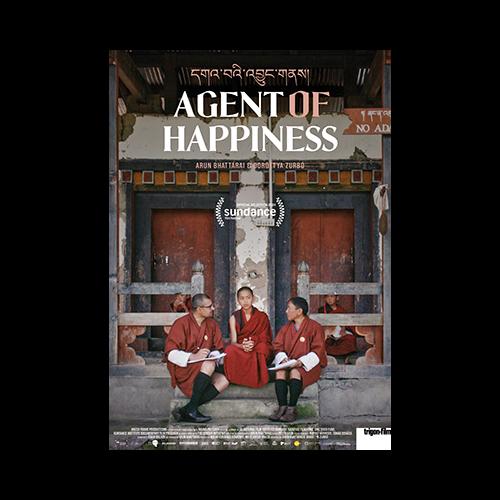Tom Schilling «Ich habe Probleme mit meiner Endlichkeit»
Im Film «Werk ohne Autor», welcher von der Biografie von Gerhard Richter inspiriert wurde, verkörpert Tom Schilling den Maler Kurt Barnert. Mit Bäckstage sprach Tom Schilling über seine Ambition die eigene Sterblichkeit zu überlisten, Florian Henckel von Donnersmarcks Hang zur Perfektion und seine eigenen künstlerischen Gemäldearbeiten.
Tom, du selbst malst und wolltest auch professioneller Maler werden. Hattest du deshalb von Anfang an eine besondere Verbindung zu Kurt, den du im «Werk ohne Autor» verkörperst?
Ich suche mir immer Figuren aus, die sich nahe an meiner eigenen Biografie befinden. Figuren, zu denen ich also eine persönliche Beziehung aufbauen kann, egal ob sie fiktiv sind oder echte Personen darstellen. Ich bin eine spirituelle Person und manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Lust zu Malen und meine Ambition daran ein Maler zu sein nur eine sehr lange und tiefe Vorbereitung für die Rolle des Kurts war. Ohne dies zu wissen. Die Kunst von Gerhard Richter, welcher Inspiration für die Rolle des Kurts war, sagt mir definitiv mehr zu als gewisse moderne Kunst, die sehr abstrakt ist. Als ich jung war, gefielen mir die klassischen Maler am besten, wie Max Liebermann, diese Art von Malern.
Was hast du gemalt?
Vor allem Portraits von Personen. Das letzte Gemälde, dass ich gemalt habe, war für einen Freund, der Vater geworden ist und ich malte die Mutter und das Kind. Ein wenig wie Maria und Jesus (lacht).
Im Film «Werk ohne Autor» geht es darum was Kunst ist und dass ein Werk, ohne persönlichen Bezug zum Künstler, nicht Kunst sein kann. Wie siehst du das? Stimmst du dem zu?
Ich stimme dem 100% zu. Dies habe ich selbst so jahrelang erlebt. Die besten Filme, die ich gemacht habe, waren Filme zu denen ich einen persönlichen Bezug herstellen konnte. Das gleiche gilt für Regisseure. Als Regisseur kannst du schon einen Film über irgendein Thema mache, aber solange dich dieses Thema nicht auch persönlich beschäftigt und bewegt, wird dein Film nicht den Effekt haben, den er könnte. Häufig ist es nicht auf den ersten Blick erkennbar.
Du magst also Autorenfilme bei denen der Drehbuchautor auch der Regisseur ist?
Absolut, auf jeden Fall. Manchmal haben gute Filmemacher Schreibblockaden wie mein guter Freund Jan Ole (Anm. der Redaktion: Gerster, Regisseur und Drehbuchautor von «Oh Boy», unser Interview mit Jan und Tom zu Film findest du hier). Ich habe einen zweiten Film mit Jan gemacht, die Story stammt diesmal aber nicht von Jan. Er suchte jahrelang nach neuem inspirierendem Stoff und fand sie in einer Geschichte eines anderen. Trotzdem ist ihm die Story persönlich sehr nahe und deshalb konnte er auch wieder aus dem Vollen schöpfen (Anm. der Redaktion, der Film heisst Lara, unsere Kritik findet ihr hier, das Interview mit Jan hier und jenes mit Tom hier).
Wie war Florian Henckel von Donnersmarck als Regisseur?
Ich denke er war sehr, sehr «oldschool» in seinem Ansatz, so wie es der Film auch ist (lacht). Der Film erinnert mich ein wenig an die grossen alten Studio-Filme der vergangenen Jahrzehnte. Jede Szene muss schön komponiert sein. Er hasst Hyper-Naturalismus, er möchte keine Picke oder Bad-Hair Days sehen. Er ist sehr daran interessiert, dass alles makellos wirkt und er ist sehr präzis in seiner Vorstellung wie die Szenen gespielt werden sollen. In gewisser Hinsicht hat er den ganzen Film bereits vor den Dreharbeiten in seinem Kopf abgespielt. Es gibt keine Improvisation auf seinem Set (lacht). Ich spreche nicht viel im Film, aber es gibt keine Szene, in der wir irgendeinen Dialog abgeändert haben.
Ist es nicht schwieriger eine Figur zu verkörpern, die sich verbal wenig äussert?
Ja absolut. Es ist schon nicht so, dass er gar nicht redet. Aber was die Figur so komplex macht, ist, dass er fast gar nicht agiert. Es dreht sich sehr viel in seinem Kopf ab. Normalerweise nutz man dazu im Filmen den Voice Over um seine inneren Gedanken nach aussen zu tragen, aber das war keine Option (lacht). Ich musste sehr nuanciert spielen und hoffen, dass ich die Zuschauer nicht langweile.
Was war bei diesen Dreharbeiten anders als sonst?
Wir hatten eine gigantische Crew für die Beleuchtung. Es gab glaub ich 10 Lastwagen voller Beleuchtungsequipment. Der Kinematograf Caleb Deschanel war glaube ich bereits 5 mal für einen Oscar nominiert und er versteht sein Handwerk vollkommen. Ich persönlich bin eher mit Filmen aufgewachsen, bei denen der visuelle Part nicht so immens wichtig war, die eher mit wenig Aufwand gedreht wurden.
Ein weiteres Thema im Film ist die Beziehung zwischen Politik und Kunst und wie die Kunst unter der jeweiligen Herrschaft neu ausgelegt wird. Heute muss Kunst, insbesondere Filme, sich auszahlen, kommerziell erfolgreich sein.
Filme stellen wahrscheinlich die teuerste Art von Kunst dar. Das ist das Gute am Malen, du brauchst nur eine Leinwand und Farben und kannst es mit wenig Kosten für viel Geld verkaufen (lacht). Ich denke ja, Filme müssen sich verkaufen, schon allein wegen der Kosten, die sie bei der Herstellung generieren. Aber ich suche immer bewusst nach zeitlosem Filmmaterial, nach Filmen, die überdauern, Filme, die du auch nach 20, 30 Jahren immer wieder gerne anschauen möchtest. Dies hat vielleicht mit meiner Angst vor dem Tod zu tun (lacht). Ich möchte, dass sich die Leute an mich erinnern. Und indem ich ein zeitloses Werk mitgestalte durch meine Darbietung lebe ich genauso ewig, wie der Film selbst.
Erstrebt nicht jeder Künstler mit seinen Werken der Sterblichkeit zu trotzen? Auch Kurt?
Nein ich denke nicht, dass dies Kurts Anreiz ist. Er ist zu gut. Irgendwie ist die Geschichte bei «Werk ohne Autor» ein Märchen und Kurt ein idealistischer Künstler. Ihm geht es definitiv um mehr als um seine Eitelkeit. Im Gegensatz zu mir, ich habe grosse Probleme mit meiner Endlichkeit.